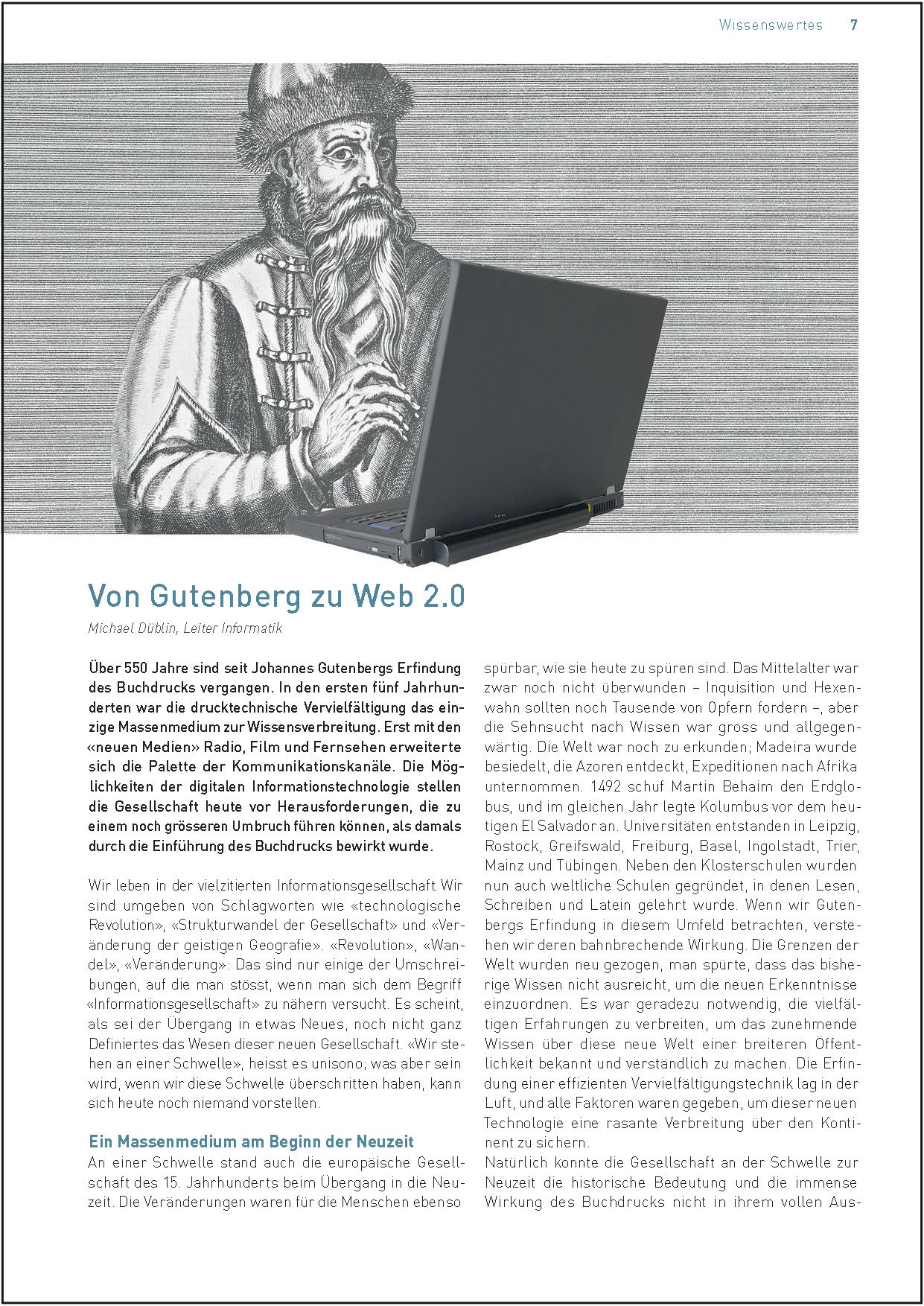Über 550 Jahre sind seit Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks vergangen. In den ersten fünf Jahrhunderten war die drucktechnische Vervielfältigung das einzige Massenmedium zur Wissensverbreitung. Erst mit den «neuen Medien» Radio, Film und Fernsehen erweiterte sich die Palette der Kommunikationskanäle. Die Möglichkeiten der digitalen Informationstechnologie stellen die Gesellschaft heute vor Herausforderungen, die zu einem noch grösseren Umbruch führen können, als damals durch die Einführung des Buchdrucks bewirkt wurde.
Wir leben in der vielzitierten Informationsgesellschaft. Wir sind umgeben von Schlagworten wie «technologische Revolution», «Strukturwandel der Gesellschaft» und «Veränderung der geistigen Geografie». «Revolution», «Wandel», «Veränderung»: Das sind nur einige der Umschrei- bungen, auf die man stösst, wenn man sich dem Begriff «Informationsgesellschaft» zu nähern versucht. Es scheint, als sei der Übergang in etwas Neues, noch nicht ganz Definiertes das Wesen dieser neuen Gesellschaft. «Wir stehen an einer Schwelle», heisst es unisono; was aber sein wird, wenn wir diese Schwelle überschritten haben, kann sich heute noch niemand vorstellen.
Ein Massenmedium am Beginn der Neuzeit
An einer Schwelle stand auch die europäische Gesellschaft des 15. Jahrhunderts beim Übergang in die Neuzeit. Die Veränderungen waren für die Menschen ebensospürbar, wie sie heute zu spüren sind. Das Mittelalter war zwar noch nicht überwunden – Inquisition und Hexenwahn sollten noch Tausende von Opfern fordern –, aber die Sehnsucht nach Wissen war gross und allgegen- wärtig. Die Welt war noch zu erkunden; Madeira wurde besiedelt, die Azoren entdeckt, Expeditionen nach Afrika unternommen. 1492 schuf Martin Behaim den Erdglo- bus, und im gleichen Jahr legte Kolumbus vor dem heutigen El Salvador an. Universitäten entstanden in Leipzig, Rostock, Greifswald, Freiburg, Basel, Ingolstadt, Trier, Mainz und Tübingen. Neben den Klosterschulen wurden nun auch weltliche Schulen gegründet, in denen Lesen, Schreiben und Latein gelehrt wurde. Wenn wir Gutenbergs Erfindung in diesem Umfeld betrachten, verstehen wir deren bahnbrechende Wirkung. Die Grenzen der Welt wurden neu gezogen, man spürte, dass das bisherige Wissen nicht ausreicht, um die neuen Erkenntnisse einzuordnen. Es war geradezu notwendig, die vielfältigen Erfahrungen zu verbreiten, um das zunehmende Wissen über diese neue Welt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt und verständlich zu machen. Die Erfindung einer effizienten Vervielfältigungstechnik lag in der Luft, und alle Faktoren waren gegeben, um dieser neuen Technologie eine rasante Verbreitung über den Kontinent zu sichern.
Natürlich konnte die Gesellschaft an der Schwelle zur Neuzeit die historische Bedeutung und die immense Wirkung des Buchdrucks nicht in ihrem vollen Ausmass erkennen. Erst mit dem Abstand von Jahrhunderten, nach generationenlanger geschichtlicher Aufarbeitung, kann heute zwischen Mittelalter und Neuzeit unter- schieden werden, wobei nach wie vor unsicher ist, ob die Völkerwanderungen, die Entdeckung Amerikas, philo- sophische Weltanschauungen, der Buchdruck oder auch alles zusammen zur Bestimmung der zeitlichen Grenzen herangezogen werden sollen.
Es stellt sich die spannende Frage, wo spätere Geschichtsschreiber ansetzen werden, wenn einst die «Informationsgesellschaft» –
oder wie immer diese Gesellschaft dann genannt wird – eine eigene zeitliche Epoche bezeichnet.
Beginn der Informationsgesellschaft?
Es stellt sich die spannende Frage, wo spätere Geschichtsschreiber ansetzen werden, wenn einst die «Informationsgesellschaft» – oder wie immer diese Gesellschaft dann genannt wird – eine eigene zeitliche Epoche bezeichnet. Wir müssen davon ausgehen, dass auch wir die historische Bedeutung der momentanen Entwicklung der digitalen Informationsverarbeitung noch gar nicht einschätzen können. Nur aufgrund unseres Geschichtswissens und der Tatsache, dass wir uns mitten in einem Wandel befinden, können wir ungefähr ermessen, an welcher epochalen Schwelle unsere Gesellschaft erneut steht. Inwiefern sind Vergleiche mit dem damaligen Umbruch zulässig, der uns zur «modernen Gesellschaft» geführt hat, von der wir uns nun möglicherweise in die «nächste Gesellschaft», wie es der Ökonom Peter F. Drucker nennt, verabschieden?
War damals an der Schwelle zur Neuzeit der Buchdruck Ausdruck und Auslöser eines Wandels, ist heute möglicherweise die Erfindung des Computers als Initialzün- dung für einen neuen Umbruch anzusehen.
Von Web 2.0 zu Web 3.0, 4.0 …
Obschon die Erfindung des Computers als elektromechanische, programmgesteuerte binäre Rechenmaschine durch Konrad Zuse nun auch schon 70 Jahre zurückliegt, ist der weltweite Datenaustausch über Rechnernetzwerke vergleichsweise neu. Das kommerzielle Internet ist – je nach Betrachtungsweise – noch keine 20 Jahre alt. Das Web steckt also noch im Teenageralter – oder ist, wenn wir das im Vergleich zu 550 Jahren Buchdruck sehen, noch nicht einmal den Windeln entwachsen. Dennoch fangen wir schon damit an zu kategorisieren. Web 2.0 heisst das neue Schlagwort, von dem Tim Berners-Lee, der Erfinder des «World Wide Web», sagt: «I think Web 2.0 is of course a piece of jargon, nobody even knows what it means.» Doch noch während die Diskussion über 2.0 im Gange ist, wird munter weitergezählt: Web 3.0 (semantisches Web) und Web 4.0 (WebOS) sind bereits in aller Munde. Das Zauberwort Web X.0 suggeriert zudem, das Internet würde ständig neu erfinden.
Technisch getrieben von höheren Bandbreiten, zunehmender Verfügbarkeit des Netzzuganges über öffentliche Hotspots, flexibler Nutzbarkeit via Smartphones und anderen Endgeräten, etablieren sich Dienste wie Blogs, Wikis, Podcasts, Online-Communities und Videoportale, die in dieser Form, in dieser Breite bisher nicht unseren Alltag durchdringen konnten. Bewegungen innerhalb sozialer Netzwerke, wie Protestbekundungen in Ägypten und im Iran, zeigen unzweifelhaft auch gesellschaftliche und politische Wirkung. Die Menschen wollen sich nicht nur Informationen beschaffen, sondern diese auch ver- arbeiten, weiterleiten, kommentieren, diskutieren und mitgestalten. Und das zu jeder Zeit an jedem Ort. Wir haben bei diesem grossen Ausmass an Interaktivität ei- nerseits mit einer Verdichtung der Informationen selbst, anderseits mit einer Globalisierung der Informations- vermittlung zu tun. Und das ist das wohl entscheidend Neue daran, das nicht nur den Begriff Web 2.0 ausmacht, sondern auch unsere Medienkultur vor neue Gegebenheiten stellt.
Kommunikation via Netzwerk ist unkörperlich und die Augenblick- lichkeit der theoretisch unendlichen Anzahl gleichzeitiger Verbindungen gedanklich nur schwer zu fassen.
Exponentieller Wissenszuwachs
Seit Gutenbergs Erfindung wurden grosse und manchmal auch wahnwitzige Entdeckungen gemacht. Die Vervielfältigung und Verbreitung des Wissens hat zwangsläufig zu grossen Veränderungen geführt und die moderne Gesellschaft eingeleitet. Wenn Wissen jedem zugänglich ist und von jedem mitgestaltet wird, vermehrt es sich auch exponentiell. Grosse Erfindungen konnten nur aufgrund allgemein zugänglichen Wissens vorbereitet, dokumentiert und schliesslich verwirklicht werden.
Umso erstaunlicher ist, dass sich seit Gutenberg am Leitmedium zur Wissensverbreitung selbst kaum etwas verändert hat. Das Wesen des Buchs und der gedruckten Publikation ist in all diesen Jahrhunderten dasselbe geblieben. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass sich das Wesen der Digitalisierung in den nächsten 500 Jahren nicht verändern wird, sondern auf dem heute gültigen Stand verharrt. Vielmehr muss man davon ausgehen, dass die digitale Informationsvermittlung entweder von einer Reihe neuer Erfindungen getrieben oder diese selbst antreiben wird.
Wir leben modern. Das ist keine besondere Auszeichnung, denn wir leben immer im jetzigen Zeitpunkt, in einer Realität, die wir mit allen unsern Zeitgenossen teilen. Was wir tun, worüber wir uns unterhalten, entspricht immer der momentanen Wirklichkeit. Wenn wir Dinge vorwegnehmen, die geschehen könnten, wenn die Technologien weiter in diesem Tempo vorangetrieben werden, dann tun wir dies immer von unserem gegenwärtigen Standpunkt aus – und stellen bald erstaunt fest, dass uns die eigenen Visionen meist einholen, sich beinahe unbemerkt in unser Leben schleichen, sich festsetzen und zu unserer neuen Realität werden. Wir müssen die Technik der neuen Informationsvermittlung nicht verstehen, um sie bedienen und mit ihr leben zu können. Im Gegensatz dazu ist ein Buch ein fester Körper, (be-) greifbar und überschaubar. Kommunikation via Netzwerk ist unkörperlich und die Augenblicklichkeit der theoretisch unendlichen Anzahl gleichzeitiger Verbindungen gedanklich nur schwer zu fassen. Hier liegt der grosse Unterschied und die Faszination: das Körperlose, nicht Greifbare und Unendliche der Netze.
Es trennen uns nicht nur über 550 Jahre Buchdruck- geschichte, es trennt uns eine ganze Gedankenwelt von Gutenbergs Erfindung. Die Geschichtswissenschaft der Zukunft wird sich mit diesem Umbruch beschäftigen und etliche Bücher darüber schreiben.